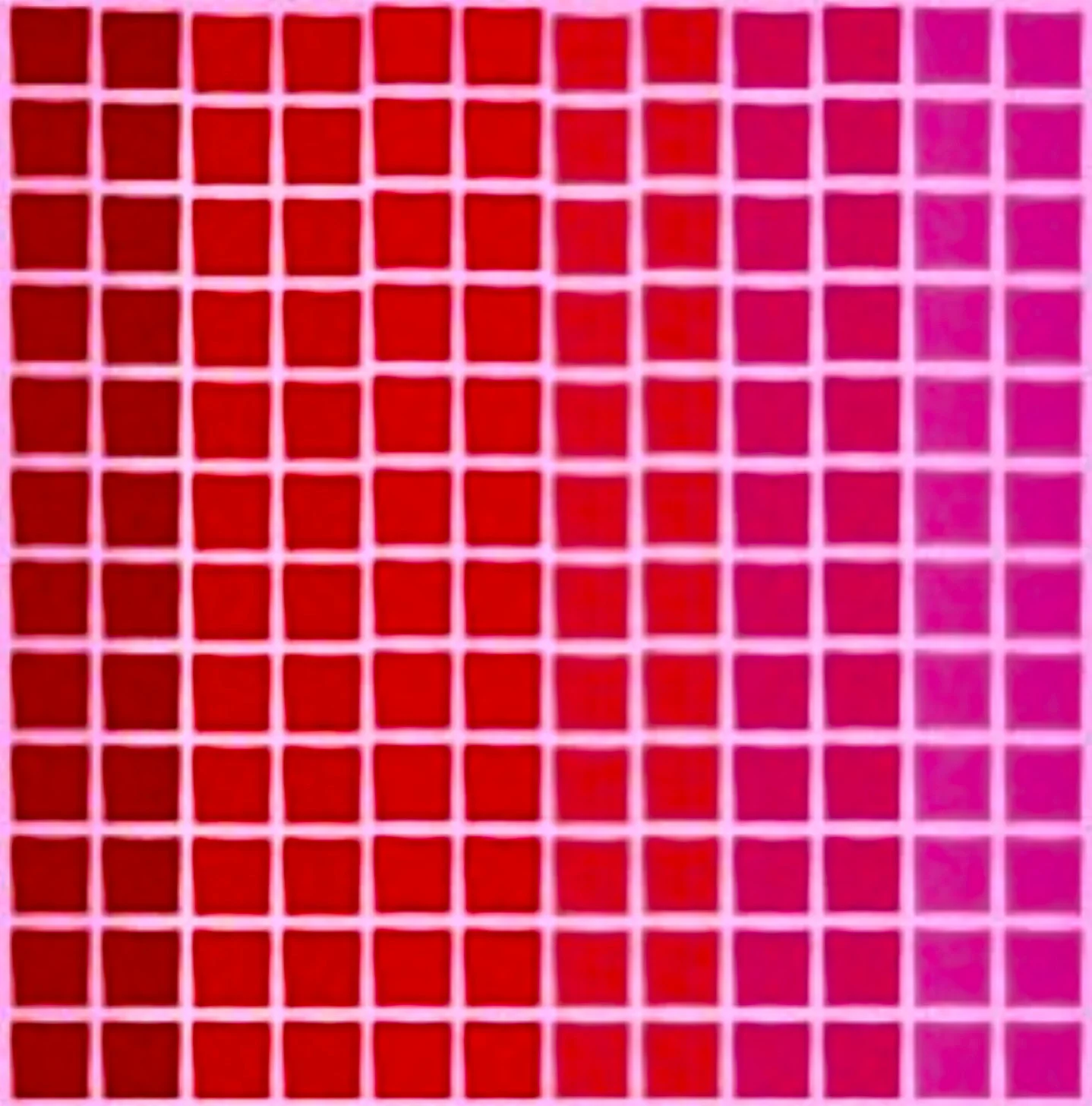
Kürzlich geriet ich mit einem Freund in eine philosophische Untiefe, als wir ein Bild von Paul Klee betrachteten. Klee war ja Meister der Variation von Farbtönen, und es ist immer wieder ein herausforderndes Vergnügen, in seinem Kosmos der Pigmente feine Unterschiede auszumachen.
Sein reifer Stil operiert mit diskreten Farbfeldern, dennoch gelingt es ihm, den Eindruck stetiger Farbübergänge zu erwecken. So auch bei besagtem Bild. Ich sah einen Übergang von Scharlach zu Eisenoxid, mein Freund dagegen einen Übergang von Purpur zu Caput mortuum. Auf diese Weise führten wir einen Moment lang eine ziemlich aufgeplusterte Fachsimpelei, selbstverständlich kamen wir zu keiner Übereinstimmung und so schlug ich eine altbewährte Tautologie vor: Rot ist nicht Rot ist nicht Rot. Aber mein Freund gab sich nicht zufrieden und fragte nun über den Rothorizont hinweg: Und wann ist Rot nicht mehr Rot?
Farbempfindungen sind trivialerweise subjektiv. Es gibt zwar Farbcodes und Farbtafeln, aber das Problem, das hier unvermittelt aus den Tiefen der Philosophiegeschichte auftaucht, ist ein allgemeineres, auch bekannt als Haufen-Paradoxon: Ein Sandkorn ist kein Sandhaufen, zwei Körner auch nicht, drei, vier, …, hundert auch nicht; wann haben wir einen Sandhaufen vor uns? Wenn wir nicht sicher sind, ob eine Person oder ein Ding eine bestimmte Eigenschaft hat, dann sagen wir, die Eigenschaft sei vage. Das kann man auf drei Arten verstehen.
Vages Wissen
Erstens erkenntnistheoretisch: Vages Wissen über eine Person oder ein Ding bedeutet mangelnde Information. Wir können aber die Realität durchaus vage erkennen. Vages Wissen ist nicht unwahr. Wenn ich von dir weiss, dass du in den Dreissigern bist, dann liege ich nicht falsch. Im Gegenteil. Verglichen mit präzisem Wissen hat vages Wissen eine grössere Chance, wahr zu sein, weil es mehr mögliche Fakten gibt, die es bestätigen können. «Du bist in den Dreissigern» kann in zehn Fällen – vom Alter 30 bis 39 – bestätigt werden, «Du bist 34» nur in einem Fall.
Daraus folgt natürlich nicht, dass man vorzugsweise vage bleiben soll. Dennoch liesse sich verallgemeinernd ein Unterschied zwischen Alltagswissen und wissenschaftlichem Wissen statuieren: Ersteres ist «wahrscheinlicher wahr» als letzteres. Wir sagen: Es ist trivial. Wissenschaft sucht das Wissen möglichst wenig vage zu machen: nichttrivial. Sie stellt deshalb Hypothesen von möglichst hoher Präzision auf. Das ist immer ein gradueller Vorgang. Zwischen Vagheit und Präzision gibt es ein Kontinuum mit dem einen Pol des Wischiwaschi und dem anderen Pol der exakten Wissenschaften. Sie verfügen über ein mächtiges Instrument, das unserer Sprache die Vagheit austreibt: die Mathematik.
«Vage» Physik
Aber selbst in der exaktesten Wissenschaft, der mathematischen Physik, spukt Vagheit herum. Die Quantentheorie gilt ja landläufig als Theorie der «Unschärfe» und des «Indeterminismus». Sie hat die alte Physik wahrscheinlichkeitstheoretisch «verschmiert». Auf die Frage «Wo befindet sich das Teilchen?» antwortet die klassische Physik eindeutig: An diesem bestimmen Ort A. Die Quantentheorie dagegen antwortet «vage»: Wir wissen es nicht, mit einer bestimmen Wahrscheinlichkeit am Ort A, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit aber auch am Ort B. Das Teilchen «befindet» sich also gleichzeitig an zwei verschiedenen Orten. Und das Verrückteste ist, dass die Quantenphysik heute solche «vagen» Zustände experimentell realisieren kann.
Vage Sprache
Vagheit ist zweitens ein linguistisches Merkmal. Unsere natürliche Sprache ist voller Mehrdeutigkeiten, Unschärfen, diffuser Grenzen. Die meisten Begriffe sind nicht klar definiert, sie haben sozusagen eine «vagierende» Bedeutung. Sie ändert sich von Kontext zu Kontext. Das macht Reiz und Reichtum der natürlichen Sprache aus.
Viele Philosophen waren und sind allerdings nicht dieser Meinung. Für sie ist die natürliche Sprache «kontaminiert» durch Vagheit. Deshalb muss sie nach dem Vorbild der formalen Logik gereinigt werden. Eine ganze, zeitweise mächtige Schule der Sprachphilosophie schrieb sich im 20. Jahrhundert dieses Projekt aufs Panier. Philosophische Probleme entstehen in den Augen ihrer Vertreter, wenn Sprache vom Schimmel der Vagheit befallen ist. Einer der einflussreichsten Sprachreiniger, Bertrand Russell, wollte auch die Mathematik auf einem makellosen formallogischen Axiomensystem aufbauen. Es gelang ihm nicht. Vielmehr machte er mit seinem Unterfangen eine der tiefsten und beunruhigendsten Entdeckungen des 20. Jahrhunderts: Mathematik ist auf «unsichere» paradoxe Grundlagen gebaut.
Vage Entitäten
Vagheit lässt sich auf eine dritte Art deuten, in der Frage: Was ist das? Sie betrifft die Seinsweise von Personen, Tieren, Pflanzen, Sachen, Artefakten, ihre «seinsmässige» Vagheit. Das heisst, Vagheit ist nicht einfach unserem dürftigen Informationsstand oder unserer begrifflichen Unschärfe anzukreiden, Vagheit liegt «in der Sache selbst». Um noch einmal auf die Quantentheorie zurückzukommen: Licht ist buchstäblich «vage»; von einer intensiven Quelle ausgesandt eine Welle, von einer schwachen Quelle ausgesandt ein Schrapnell aus Lichtteilchen, Photonen. Oder ein anderes Beispiel. In der Corona-Pandemie tauchte häufig die Frage auf: Ist das Virus ein Lebewesen oder nicht? Oft hörte man dann: «Ein Virus ist ein Lebewesen, bis zu einem gewissen Grad». Das heisst, man sieht im Virus eine vage Entität, die sich nicht einfach in ein binäres Schema – lebend oder nicht lebend – einordnen lässt. Die Biochemie befasst sich unter anderem mit dem Übergang vom Nicht-Leben zum Leben, sie studiert die Reaktionsabläufe zur Bildung von Organismen, bleibt aber vage; nicht aus Mangel an Information und Begriffsschärfe, sondern weil es auf die Frage «Ist das ein lebender Organismus?» keine universell akzeptierte eindeutige Antwort gibt. Das Virus ist eine vage Entität.
Vage Identitäten
Mit viel Bohei erklären heute woke Personen dem binären Mann-Frau-Raster den Krieg, und sie tun dies gerade, indem sie sich als vage Identitäten definieren. Zurecht argumentieren sie, dass Biologie allein die Geschlechtsidentität nicht festlegt. Das Argument beschränkt sich freilich nicht auf das Geschlecht. Vage Identität bedeutet, dass eine Person sich nicht in einer erschöpfenden Liste von Eigenschaften und Merkmalen aufzählen lässt: männlich, weiss, europäisch, Akademiker, 65-jährig, 180 cm gross, 85 kg schwer, braunhaarig, blauäugig, zuckerkrank, geschieden, arbeitslos, und und und … Diese philosophische Lektion verdanken wir dem (französischen und russischen) Existenzialismus. In seinem Sinn sind alle Menschen vage Identitäten, sie haben keine «wesentlichen» Eigenschaften, die sie ein für allemal festnageln («Existenz kommt vor Essenz»). Als wen du mich auch beschreiben magst, ich bin nicht der, den du beschreibst. Ich kann mich immer deinen kategoriellen Einfangversuchen entziehen.
Daraus erhellt sich sofort die soziale und politische Konnotation der Vagheit, denn Identifizierung bedeutet immer auch Machtausübung, Kontrolle, Überwachung, durch staatliche Behörden oder andere Institutionen. In der Vagheit steckt ein heimliches subversives Potenzial, ein Widerstand gegen das Gleichmacherische, den wir angesichts der immer potenteren Identifizierungs- und Überwachungstechnologien bewahren und pflegen sollten. Theodor Adorno sprach vom «Nicht-Identischen».
Vage Technologie
Menschliche Intelligenz ist vage, dadurch flexibel und anpassbar an veränderliche Bedingungen. Gerade darin unterscheidet sie sich von Maschinenintelligenz. Bertrand Russell schrieb 1923 einen Essay über Vagheit. Darin steht der bedenkenswerte Satz: «Das Gesetz des ausgeschlossenen Dritten ist wahr, wenn man präzise Symbole einsetzt, aber es ist nicht wahr, wenn die Symbole so vage wie alle Symbole sind.»
Dieses Schlüsselmerkmal der natürlichen Sprache verhilft uns, Entscheide auf unscharfer oder dürftiger Informationsbasis zu fällen oder mit Widersprüchen nutzbringend umzugehen. Wir brauchen dafür den Begriff der Ambiguitätstoleranz. Genau so etwas erwarten wir ja von KI-Systemen, die man in den Alltag integriert. Sie scheitern oft aufgrund ihrer sturen Binarität. Desiderat ist eine «adaptierte» KI. Seit den 1960er Jahren suchen Physiker, Mathematiker, Logiker und Ingenieure, das zentrale Charakteristikum menschlicher Intelligenz – ihre Vagheit oder «fuzzyness» – in einer präzisen Sprache zu formulieren. Und es gelingt ihnen erstaunlich gut. Die «Fuzzy Logic» kann mit Alltags-Folgerungen umgehen wie «Wenn es ein bisschen regnet, wird man ein bisschen nass». Sie ist heute Basis von «vagen» Algorithmen, die auf zahlreichen technischen Gebieten Anwendung finden: nicht-binäre künstliche Intelligenz.
Sie erscheint heute umso dringlicher, als smarte Geräte sich in unserem Alltag einbürgern, Geräte also, die autonom «Entscheidungen» treffen. Nehmen wir die automatisierte Gepäckaufnahme als Beispiel. Das System funktioniert deterministisch, nach vorgegebenen Regeln. Angenommen, ich habe einen Koffer, der um dreihundert Gramm zu schwer ist. «Dreihundert Gramm zu schwer» bedeutet für das Gerät eine eindeutige binäre Anweisung: den Koffer nicht akzeptieren. Ich muss also den Koffer um Dinge erleichtern, bis er die Norm erfüllt. Vielleicht hätte ein Beamter, der die Gepäckaufnahme kontrolliert, ein Auge zugedrückt. Aber das Gerät kennt kein Erbarmen, sprich: Ambiguitätstoleranz.
Kompetente Vagheit
Unsere Ära wertet das Eindeutige, das Binäre, gegenüber dem Uneindeutigen, Vagen sehr hoch, unverhältnismässig hoch. Das zeigt sich heute zum Beispiel auch in der Polarisierung des öffentlichen Diskurses. Aus der Perspektive der Logik mag es streng genommen widersprüchlich erscheinen, dass eckig zugleich rund ist, oder wahr zugleich falsch. Aber nicht strikte Logik regiert den normalen Umgang zwischen Menschen, sondern – wie man sie nennen könnte – kompetente Vagheit. Ein Sinn für das «Tertium datur»: Es gibt ein Drittes zwischen angeblich unvereinbaren Positionen. Dafür sorgt die Geschmeidigkeit der natürlichen Sprache.
In dem Masse, in dem wir also in unseren Kontroversen dem Vagen seinen Platz einräumen, können wir harte gegensätzliche Positionen puffern. Damit ist nicht einem schlingernden Argumentieren das Wort geredet, vielmehr der Einsicht, dass sich die Bedeutung unserer Begriffe den jeweiligen Umständen anpassen lässt. Wie schrieb Georg Christoph Lichtenberg: «Man muss zuweilen wieder die Wörter untersuchen, denn die Welt kann wegrücken und die Wörter bleiben stehen.»