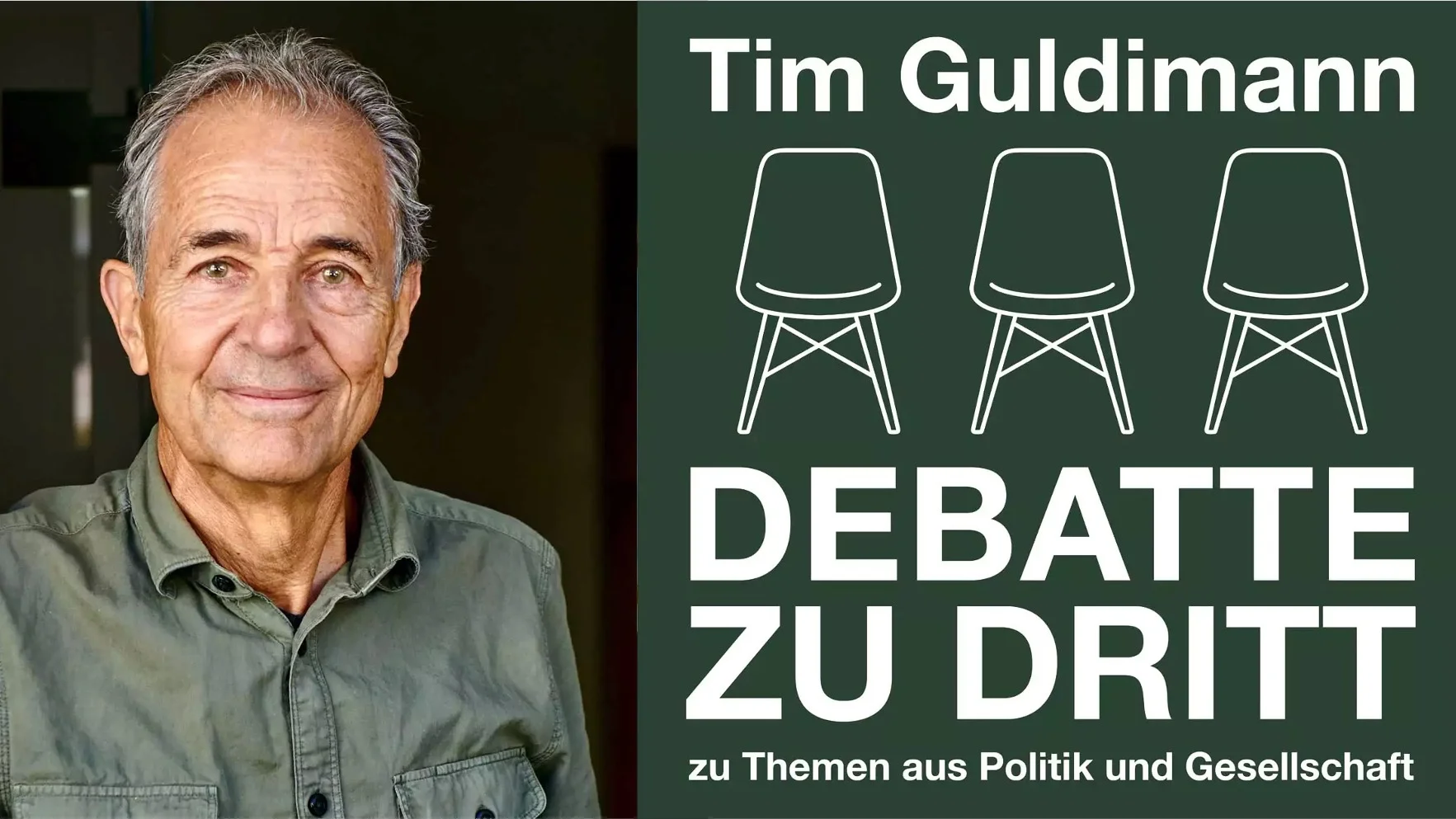
Warum verkennen wir die Bedeutung des dualen Bildungssystems? Darüber diskutiert Tim Guldimann mit Ursula Renold, Professorin für Bildungssysteme an der ETH Zürich und ehemalige Staatssekretärin für Berufsbildung und Technologie, und Rudolf Strahm, ehemaliger Nationalrat, Preisüberwacher und langjähriger Lehrbeauftragter für die Ausbildung von Berufsberatern und Berufsberaterinnen.
Die Schweiz nimmt im internationalen Vergleich stets wirtschaftliche Spitzenplätze ein. Dabei verdankt sie ihre Innovationsfähigkeit, ihr Wirtschaftswachstum und ihre tiefe Arbeitslosigkeit vor allem dem dualen Bildungssystem. Warum verkennen wir dessen Bedeutung? Darüber diskutiere ich mit Ursula Renold, Professorin für Bildungssysteme an der ETH Zürich und ehemalige Staatssekretärin für Berufsbildung und Technologie, und Rudolf Strahm, ehemaliger Nationalrat, Preisüberwacher und langjähriger Lehrbeauftragter für die Ausbildung von Berufsberatern und Berufsberaterinnen.
Aus drei Gründen, so Ruedi Strahm sei «die Berufslehre (…) ein Erfolgsmodell: Erstens ist die Berufslehre eine Art Armutsverhinderungsvehikel (…) Die Berufsbildungsländer, nicht nur die Schweiz, auch Deutschland, Österreich, Holland und Dänemark haben eine markant tiefere Jugendarbeitslosigkeit». Zweitens sei sie «ein Vehikel für höhere Arbeitsproduktivität (…) Die Berufsbildungsländer haben bedeutend höhere Löhne». Und drittens, «ist die Berufslehre mitverantwortlich für die hohe Innovation, weil die Berufsbildung wichtig ist, Innovationen rasch zu verbreiten». Als Beispiel führt Strahm die Herstellung von medizinischen Implantaten und Prothesen auf, wo die Schweiz weltweit führend sei. Der Erfolg beruhe auf der engen «Zusammenarbeit von Chirurgen und Mechanikern (…) auf Augenhöhe». Die Mechaniker seien in den Operationssaal und der Chirurg in die Werkstatt gekommen und zusammen hätten sie «mit neuen Formen und neuen Materialien (…) getüftelt». Ursula Renold bestätigt diese Zusammenhänge. Ihrer Untersuchungen beweisen, dass eine hohe Innovationsleistung auf dem «Zusammenspiel» von Berufspraktikern, den «Tüftlern», mit theoretischen Hightechkompetenzen beruhe. Die Firma Logitech habe so weltweit die ersten Computermäuse entwickelt.
Doch was sind die Hindernisse für die gesellschaftliche Anerkennung der Berufsbildung? Beide Gesprächspartner weisen auf den grossen Einfluss der akademisch orientierten französischen und britischen Bildungsideologie auf die OECD und damit auf die internationalen Vergleiche «des schulisch kognitiven Wissens» hin. Bis 2001, so Strahm, habe «die OECD die schweizerische Berufslehre gar nicht anerkannt». Diese Ideologie sei in den 70er-Jahren vor allem von Daniel Bells Theorie der «Knowledge Society» geprägt worden. Die «praktische Intelligenz», die «soft skills», gerieten dadurch, so Strahm, ins Hintertreffen: «Exaktheit, Zuverlässigkeit, Termintreue, Verantwortungsbewusstsein etc.». Diese, so Renold «bekommen eine immer grösser Bedeutung (…), weil wir uns in einer hochgradigen Veränderung befinden, die von der digitalen Tansformation herstammt». Dafür seien «heute die Schulen zu langsam und die Universitäten erst recht». Der Fachkräftemangel, so Strahm, äussere sich «heute vor allem im Bereich der Leute mit höherer Berufsbildung».
In der Frage, ob fehlende, mit dem universitären Bachelor vergleichbare Titel ein Prestigeproblem für die Berufsbildung seien, besteht keine Einigkeit: Während Strahm sich klar «aus der Sicht der Berufsberater» für den «Professional Bachelor» ausspricht, warnt Renold vor einer Titelinflation. Das Prestige der Berufsausbildung sei auch durch den europäischen Qualifikationsrahmen gewährleistet.
Auf die Frage, ob sich das Berufsbildungssystem auf andere Gesellschaften mit anderen Traditionen übertragen lasse, antwortet Renold: «Nein, das geht nicht.» Was aber helfe, seien die Resultate der Erforschung der eigenen Erfahrungen. Wichtig sei vor allem der politische Willen der Eliten. In China werde Berufsbildung, so Strahm «einfach diktiert von oben (…): Jede Firma muss ausbilden».
Für die weitere Entwicklung der Berufsbildungsländer sind Renold und Strahm zuversichtlich, in Deutschland jedoch, so Strahm, erhalte «die Berufslehre nach und nach ein soziales Stigma».
Klicken Sie auf eines der untenstehenden Icons, um die aktuelle Ausgabe von «Debatte zu dritt» zu hören.
Journal 21 publiziert diesen Beitrag in Zusammenarbeit mit dem Podcast-Projekt «Debatte zu dritt» von Tim Guldimann.

