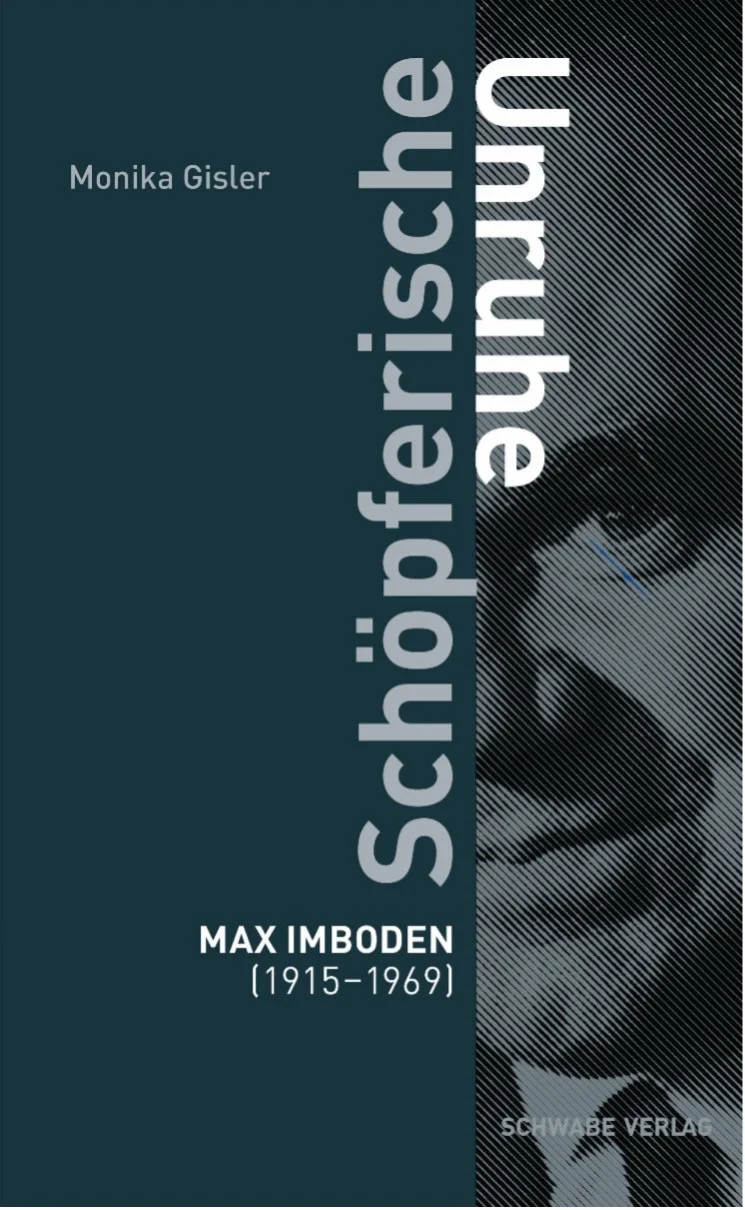Der Hochschullehrer Max Imboden sah schon 1964 im Wohlstand der Schweiz eine lähmende Gefahr. Monika Gisler erinnert in ihrem neuen Buch «Schöpferische Unruhe» an den renommierten Staatsrechtler, der kritische Analyse mit dem Appell zu lebendiger Demokratie verband. Eine lesenswerte Schrift.
Millionen zog sie in ihren Bann, die Schweizerische Landesausstellung: Die Expo 64 spiegelte das damalige Schweizer Selbstverständnis als wohlhabende, fortschrittliche und zugleich traditionsbewusste Nation, eine Welt im Glanz von Konsum- und Technikoptimismus, flankiert vom berühmten «Beton-Igel». Er erinnerte symbolhaft an die geistige Landesverteidigung. Der zylindrisch-stachelige Militärpavillon stand für die Verteidigungsbereitschaft im Kalten Krieg. Ein Publikumsmagnet, der Film «Wehrhafte Schweiz», demonstrierte sie.
Mit der Klasse standen wir vor diesem monumentalen Bau. «Und, was ist nun das Komplementäre zu diesem Betonbunker?», fragte unser Geschichtslehrer. Denn, so ergänzte er sinngemäss, was verschieden sei, das diene einem grösseren Ganzen. Darum sei das andere stets mit zu bedenken – als notwendige Ergänzung und in engem Zusammenspiel, fügte er bei. Beredtes Schweigen! Niemand hatte eine schnelle Antwort.
Das Problem der Schweiz: saturierte Stagnation
Er lese soeben einen brisanten politischen Essay, erklärte unser Lehrer: «Helvetisches Malaise» von Max Imboden, einem renommierten Staatsrechtler (1). Da höre ich ihn zum ersten Mal, diesen Namen, und auch das Wort vom «helvetischen Malaise». Wie uns das irritiert hat! Die Schweiz und ihr «Expo»-Selbstverständnis wurden mit dem pejorativen Begriff vom Malaise verbunden. Der nagende Zweifel inmitten dieser ungebrochenen 64er-Zuversicht!
Max Imbodens Essay warf hohe Wellen. Seine Schrift hat mich nie mehr losgelassen. Erst später ist mir bewusst geworden, wie sehr sie ein Tabu gebrochen hat: Die gelobte politische Stabilität der Schweiz wurde plötzlich als Krankheitssymptom beschrieben. Das Kernproblem der Schweiz bestünde nicht in einer klassischen Krise, sondern in der saturierten Stagnation und in unterschwelliger Trägheit, meinte Max Imboden. Die Zeichen der Zeit ernst zu nehmen, darauf drängte er. Das Land sei mit seiner «Bequemlichkeit im Wohlstand» erstarrt; ruhe sich selbstzufrieden auf alten Erfolgen aus und sei zu Reformen unfähig. Er forderte eine geistige Erneuerung, den Mut zum Aufbruch und die Skepsis gegenüber der eigenen Trägheit. Nur so bleibe Demokratie lebendig. Es seien «die schöpferischen Spannungen», die das Land vor Krisen bewahrten – und zwar von aussen wie von innen.
Ein Befund, der bleibt
Sechzig Jahre später liest sich Max Imbodens Diagnose erstaunlich aktuell. Nicht umsonst spricht Daniel Woker im Journal 21 vom «Helvetischen Malaise 2.0» (2). Die Themen haben sich verschoben, doch gewisse Muster bleiben sich ähnlich. Imbodens Warnung klingt darum wie eine Zeitreise. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit und als Staatsform aktiv mitzugestalten. Sie lebt vom «Get involved!» der Bürgerinnen und Bürger, von ihrem wachen Engagement.
Max Imboden: Denker der aktiven Demokratie
Da kommt ein Buch zur richtigen Zeit. «Schöpferische Unruhe. Max Imboden (1915–1969)» heisst die Publikation von Monika Gisler (3). Die freischaffende Historikerin und ETH-Dozentin publiziert keine klassische Biografie im Sinne eines umfangreichen Lebenswerkes; sie verbindet die Lebensskizze mit einer politisch-ideengeschichtlichen Analyse. Sie will Max Imboden als wichtigen Staatsrechtler und Mahner für Demokratie, Freiheit, Rechtsstaat in der Schweiz neu lesbar machen und seine gewichtige Stimme hörbar.
Es gibt Menschen, deren Denken die Gegenwart zu überdauern scheint, weil sie über den eigenen Moment hinaus auf die Verantwortung des Einzelnen gegenüber der Gesellschaft blicken. Einer von ihnen ist der Staatsrechtler und Hochschullehrer Max Imboden, ein praxisbezogener Intellektueller, der die Demokratie nicht als gegeben hinnahm, sondern als fortwährende, fordernde Aufgabe verstand. «Politische Strukturen sind nie eine Selbstverständlichkeit und es lohnt sich, für sie zu kämpfen», notierte Imboden, dessen Worte heute nachhallen, weil sie an die Verantwortung erinnern, die wir alle für Freiheit und Recht tragen. In diesem Sinne ist wohl auch sein Mandat als Nationalrat zu verstehen.
Max Imboden als Verfassungsschreiber
Imboden sah in Verfassung und Gesetz nicht blosse Organisationspläne und Technik, sondern lebendige Verträge. Ihre Geltung und ihr Sinn werden nur durch die achtsame und wachsame Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger gesichert. Das zeigte sich exemplarisch in Nidwalden. Für den Urschweizer Halbkanton (4) schuf er 1965 eine neue Verfassung. Darin realisierte er staatsrechtliche Vorstellungen, die er zuvor in Lehre und Publikationen entwickelt hatte.
Max Imboden wollte zeigen, dass selbst ein kleiner Landsgemeinde-Kanton in der Lage war, eine moderne, rechtsstaatliche Ordnung zu schaffen, die Grundrechte sichert, Gewaltenteilung klar definiert und Regierung wie Parlament stärkt. Indem er zugleich Bildungs- und Kulturaufgaben verankerte, verband er die demokratische Tradition der Landsgemeinde mit den Anforderungen einer zeitgemässen Staatsführung. Ein Modell, das Herkunft und Moderne miteinander versöhnte. So wurde Nidwalden für einen Moment zu jener «kleinen Musterschweiz», die Imboden vorschwebte. (5)
In concreto wirken und so etwas bewirken
In der realen Welt etwas bewirken, das war das Ziel des tiefschürfenden Theoretikers. Darum hat er als Hochschullehrer Werkseminare durchgespielt und mit seinen Studierenden beispielsweise eine Schweizer Bundesverfassung, «wie sie sein könnte», entworfen. Sein «Helvetisches Malaise» prägte ganz wesentlich den Weg zu einer Revision der Bundesverfassung. Allerdings ist es nicht zur Totalrevision der BV von 1874 gekommen, wie es dem innovativen Staatsrechtler Imboden immer vorgeschwebt hat. Die Zeit war noch nicht reif.
Niedergeschrieben aber hat Imboden seine BV-Vision trotzdem. Und zwar innert dreier Wochen. 1968 weilte er an der Schweizer Botschaft in Ankara. Hier verfasste er eine neue Bundesverfassung. Lange Zeit später wurde sie irgendwo in einem bundesrätlichen Archiv gefunden.
Wenn Freiheit Arbeit verlangt: Max Imboden heute
Max Imboden warnte stets vor Stillstand und der Illusion, dass Freiheit automatisch bestehen werde: «Wer Demokratie bewahren will, darf sich nicht mit Stillstand zufriedengeben.» Es ist diese Mischung aus scharfem Verstand, ethischem Anspruch und politischer Sensibilität, die ihn auch Jahrzehnte nach seinem Wirken wichtig erscheinen lässt.
Monika Gisler gelingt es, Imbodens Denken historisch fundiert zu verorten, zugleich aber auf die Gegenwart zu spiegeln. Entstanden ist kein nüchternes Gelehrtenporträt, sondern eine inspirierende Ermutigung zu Engagement, kritischem Nachdenken und zur stetigen Erneuerung der Demokratie. Für Leserinnen und Leser, die jenseits von Schlagzeilen über Macht, Verantwortung und gesellschaftliche Freiheit reflektieren wollen, bietet «Schöpferische Unruhe» reichhaltige Einsichten – intellektuell anregend, politisch aktuell, sorgsam durchdacht.
Politisches Denken und Handeln brauchen Komplementäres
Gislers Buch über den Denker und Demokraten Max Imboden ist ein feinsinniges Plädoyer, wachsam gegenüber starren Strukturen zu bleiben, Verantwortung für die Res publica zu übernehmen und politisches Leben als kreative Herausforderung zu begreifen.
Wer die Publikation liest, spürt: Demokratie ist nicht gegeben, sie muss erarbeitet und mitgedacht sein. Vielleicht ist es das, was unser Geschichtslehrer damals vor dem Beton-Igel andeuten wollte – das Komplementäre zur Wehrhaftigkeit: Es ist Max Imbodens produktive Wachsamkeit einer Gesellschaft, die Pflicht zur «schöpferischen Unruhe». Doch wie viel Unruhe verträgt eine Demokratie, ohne selbst daran zu zerbrechen? Darauf hätte er sicher eine Antwort.
(1) Max Imboden: Helvetisches Malaise. Zürich: EVZ-Verlag, 1964; dazu: Georg Kreis (Hg.): Helvetisches Malaise von Max Imboden. Ein historischer Zuruf und seine überzeitliche Bedeutung. Zürich: NZZ Libro, 2011.
(2) https://www.journal21.ch/artikel/plaedoyer-fuer-eine-offene-schweiz [abgerufen: 25.09.2025]
(3) Monika Gisler: Schöpferische Unruhe. Max Imboden (1915-1969). Basel: Schwabe Verlag, 2025, 204 Seiten.
(4) Die neue Bundesverfassung von 1999 schaffte den Status der Halbkantone ab.
(5) Nidwalden als «kleine Musterschweiz»: Was Imboden mit seinen – grossen und kleinen – Verfassungsentwürfen versuchte, zeigt Monika Gisler im Kapitel «Die Verfassung in der Praxis: Eidgenossenschaft» eindrücklich auf.